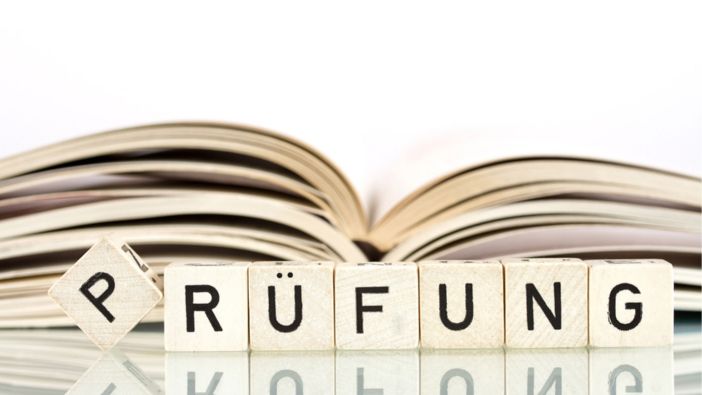Gymnasium
Das Gymnasium umfasst die Klassen 7 bis 12. Es vermittelt den Schülerinnen und Schülern entsprechend ihren Leistungen und Neigungen eine vertiefte und erweiterte allgemeine Bildung mit dem Ziel, ihren Bildungsweg an einer Hochschule fortzusetzen oder aber auch eine berufliche Ausbildung zu beginnen.

Gymnasien können Förderklassen für Schüler mit besonderen Fähigkeiten führen, z.B. für Hochbegabte. Außerdem gibt es anerkannte Sport- oder Musikgymnasien. Diese Gymnasien können die Klassen 5 und 6 als schulartunabhängige Orientierungsstufe führen. Sie können ab der Jahrgangsstufe 7 auch Klassen führen, die auf die Berufsreife und die Mittlere Reife vorbereiten. Die Entscheidungen trifft die Schulkonferenz im Einvernehmen mit dem Schulträger.
Gymnasiale Oberstufe
Die gymnasiale Oberstufe umfasst die Klasse 10 als Einführungsphase sowie die Klassen 11 und 12 als Qualifikationsphasen. Der Unterricht findet in einer Kombination von Pflicht-, Wahl- und Wahlpflicht-Unterricht statt. Am Ende der erfolgreichen gymnasialen Oberstufe wird die allgemeine Hochschulreife erworben, die sich aus der Abiturprüfung und den Leistungen in der Qualifikationsphase zusammensetzt.
Gemeinsame Abituraufgabenpools der Länder
Mecklenburg-Vorpommern strebt langfristig ein bundesweit vergleichbares Abitur in den Kernfächern an, um die Anerkennung und Gleichwertigkeit aller Schulabschlüsse zu gewährleisten.
Auf der Grundlage von Beschlüssen der Kultusministerkonferenz werden für die Fächer Deutsch und Mathematik, für die fortgeführten Fremdsprachen Englisch und Französisch sowie für die naturwissenschaftlichen Fächer Biologie, Chemie und Physik auf der Basis der Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife ländergemeinsame Abituraufgabenpools entwickelt. Dies soll insbesondere dazu beitragen, die mit den Abiturprüfungen der Länder verbundenen Anforderungen anzugleichen und die hohe Qualität dieser Prüfungen zu sichern. Mit der Koordination der Entwicklung der Pools wurde als wissenschaftliche Einrichtung der Länder das IQB beauftragt.
Für die Fächer Deutsch, Englisch, Französisch und Mathematik stehen den Ländern seit dem Prüfungsjahr 2017 Abituraufgabenpools zur Verfügung. Ab dem Prüfungsjahr 2025 werden auch für die naturwissenschaftlichen Fächer Biologie, Chemie und Physik ländergemeinsame Pools bereitgestellt.
Gemeinsame Standards zum Abitur
Die Kultusminister der Länder haben im Herbst 2012 einheitliche Leistungsanforderungen für die gymnasiale Oberstufe und das Abitur in allen 16 Bundesländern festgelegt. Die verbindlichen Bildungsstandards gelten für die Fächer Deutsch, Mathematik und fortgeführter Fremdsprache (Englisch/Französisch).